Janets Bologna Guide: Kulinarik, Kultur, Pasta und Ehrfurcht
Montag, Juli 28, 2025Es gibt Städte, in denen man einfach nur zu Gast ist – und es gibt Bologna. Eine Stadt, die sich nicht aufdrängt, aber auch nichts beweise...
Es gibt Städte, in denen man einfach nur zu Gast ist – und es gibt Bologna. Eine Stadt, die sich nicht aufdrängt, aber auch nichts beweisen muss. Die nicht laut schreit: „Schau her!“, sondern einfach dasitzt, in warmes Licht getaucht, mit offenen Türen, langen Portiken und einer leisen Selbstverständlichkeit. Ich liebe Bologna für genau das: für ihre Unaufgeregtheit. Für die Art, wie sich das Leben hier zwischen Buchhandlungen, Trattorien und piazze abspielt, als hätte niemand je vergessen, worauf es wirklich ankommt. Es ist diese Mischung aus Kultur und Körperlichkeit, aus Denken und Genießen, aus Geschichte und Alltag, die mich immer wieder tief berührt. Bologna, überall als "La Rossa, la Dotta, la Grassa" bekannt, fühlt sich für mich nicht an wie ein Reiseziel, sondern wie ein Zustand – ein Ort, an dem Kopf und Herz zur Ruhe kommen, gemeinsam essen gehen und bis spät in die Nacht durch die Gassen streifen.
Wieso ist Bologna die Rote, die Gelehrte, die Fette?
La Rossa – die Rote bezieht sich auf mehrere Dinge zugleich. Einerseits: Die Farbe der Stadt: Bologna ist bekannt für ihre warmen, erdigen Terrakotta- und Ziegeltöne, die viele Fassaden und Dächer prägen. Wer durch die Altstadt läuft, sieht tatsächlich fast nur Rottöne – von Ziegelrot bis Ocker. Und andererseits die politische Bedeutung: Bologna war lange Zeit eine Hochburg der italienischen Linken. Über Jahrzehnte hinweg galt die Stadt als eines der wichtigsten Zentren kommunistischer und sozialistischer Politik in Italien. Die Bezeichnung "Rossa" ist also auch ein Verweis auf diese politische Prägung.
La Dotta – die Gelehrte: Bologna ist Heimat der ältesten Universität Europas, gegründet im Jahr 1088. Die Università di Bologna war ein zentraler Ort der mittelalterlichen Gelehrsamkeit und ist bis heute eine international renommierte Bildungsstätte. Die Bezeichnung „die Gelehrte“ verweist also auf die jahrhundertelange akademische Tradition, insbesondere in den Bereichen Recht, Medizin und Philosophie. Gleichzeitig aber auch auf die lebendige und progressive studentische Kultur, die das Stadtbild bis heute prägt – mit intellektuellen Diskursen, Literatur, politischen Debatten und einem gewissen Bildungsstolz.
La Grassa – die Fette: Diese Bezeichnung ist eine Hommage an die kulinarische Opulenz der Stadt und der gesamten Region Emilia-Romagna. Bologna ist die Heimat von Tortellini, Tagliatelle al ragù (nicht Spaghetti Bolognese!), Mortadella und vieler anderer reichhaltiger Spezialitäten. „Fett“ ist hier liebevoll gemeint – im Sinne von üppig, genussvoll, bodenständig, eine Stadt, die das Essen zelebriert, ohne Zurückhaltung, ohne Dogma. Die Küche ist ein zentrales Element der Identität – Essen ist hier kein bloßes Mittel zum Zweck, sondern Ausdruck von Geschichte, Gemeinschaft und Hingabe.
Zwei Türme, Altstadt und mehr: Woran kann ich mich orientieren?
Mitten in Bologna ragen sie in den Himmel – schief, schroffer als gedacht und dennoch erstaunlich elegant: die Due Torri, die zwei mittelalterlichen Türme „Asinelli“ und „Garisenda“. Sie sind nicht nur Wahrzeichen, sondern auch Zeugen einer Zeit, in der Höhe Macht bedeutete – und Rivalität aus Stein gebaut wurde. Der höhere der beiden, der Torre degli Asinelli, lässt sich besteigen. 498 Holzstufen führen hinauf – und mit jedem Schritt wird das mittelalterliche Mauerwerk enger, die Luft wärmer, das Herz etwas schneller. Oben dann: eine Aussicht, die fast unwirklich wirkt. Terrakotta-Dächer bis zum Horizont, ein sanftes Rot, das Bologna seinen Spitznamen „La Rossa“ eingebracht hat. Und irgendwo da unten: das eigene kleine Leben, das plötzlich angenehm unwichtig erscheint. Der kleinere Turm, Garisenda, ist inzwischen zu schief für Besucher*innen. Dante erwähnte ihn schon in seiner Divina Commedia – mit Bewunderung, aber auch mit einem gewissen Unbehagen. Vielleicht weil es etwas Beunruhigendes hat, wenn sich etwas, das eigentlich fest sein sollte, so sichtbar neigt.
Der Piazza Maggiore ist kein Platz, den man einfach „besichtigt“. Er ist eher ein Platz, den man erlebt – manchmal auch einfach durch das bloße Stehenbleiben. Man spürt ihn, lange bevor man ihn durchquert: das offene Herz der Stadt, auf dem alles zusammenkommt – Geschichte, Gegenwart, Gelassenheit. Die altehrwürdigen Fassaden – Palazzo d’Accursio, Basilica di San Petronio, der Neptunbrunnen gleich daneben – sind wie Kulissen, und trotzdem wirkt nichts davon unecht. Tagsüber schieben sich Schulklassen über das Pflaster, nachts sitzen Menschen barfuß auf den Stufen, mit Pizza in der Hand und Blick in den Himmel. Es gibt kaum einen Ort, an dem sich der Charakter Bolognas so verdichtet wie hier: politisch, lebendig, etwas unaufgeräumt, voller Würde. Ein Platz, der nicht schreit, sondern flüstert – und gerade deshalb lange nachhallt.
 |
| Fassade der Basilica di San Petronio auf dem Piazza Maggiore |
Basilica di Santo Stefano: Ein Gang durch die Zeit
Wenige Minuten vom Trubel entfernt liegt ein Ort, der sich fast wie ein Geheimnis anfühlt: die Basilica di Santo Stefano – eigentlich ein ganzer Komplex aus mehreren ineinander verschachtelten Kirchen. Sie wird oft „Sette Chiese“ genannt, auch wenn es heute nur noch vier oder fünf davon wirklich gibt. Wer sie betritt, verlässt das Jetzt. Es ist dunkel, kühl, fast ehrfürchtig still. Keine große Geste, kein goldener Prunk – nur Backstein, Schatten, uralte Böden und der leise Klang der eigenen Schritte. Hier ist das Christentum nicht inszeniert, sondern geerdet. Vielleicht ist es genau diese Stille, die so tief wirkt. Oder die Tatsache, dass sich in diesem verwinkelten Bau so viele Epochen überlagern, ohne sich zu stören: frühchristlich, romanisch, gotisch – alles da, alles nebeneinander. Santo Stefano ist weniger ein Ort zum Fotografieren als zum Verweilen. Zum Fragen. Zum Lauschen.
Das Studierendenviertel beginnt direkt hinter der Piazza Verdi, dort, wo Menschen sitzen, als hätte niemand je Prüfungen, niemand je Angst, niemand je Zweifel. Zwischen Bars, Secondhandläden, copy shops und winzigen Kiosken ist Bologna am ehrlichsten. Nichts hier ist wirklich hübsch – aber alles hat Haltung. Hier riecht es nach Espresso, nassem Papier, nach Zigarettenrauch und manchmal, wenn man Glück hat, nach etwas, das jemand gerade frisch gekocht hat.
 |
| Die hölzerne Decke des Teatro Anatomico in Bologna |
Ehrfurcht und Menschheitsgeschichte: Das Teatro Anatomico
Es gibt Orte, die wirken nicht wie Räume, sondern wie Gedanken, die jemand einmal sehr ernst gemeint hat. Das Teatro Anatomico in Bologna ist so ein Ort. Versteckt im ersten Stock des alten Palazzo dell’Archiginnasio, dort, wo einst die klügsten Köpfe der Stadt disputierten, öffnet sich plötzlich ein hölzernes Amphitheater, das aussieht, als hätte jemand ein Herz aus Tannenholz geschnitzt. Klein, rund, geschlossen. Alles ist auf den Tisch in der Mitte ausgerichtet. Und dieser Tisch – eiskalt, marmorweiß – war einst der Ort, an dem man schnitt, sezierte, erklärte, sezierte, erklärte, sezierte.
Ich stelle mir vor, wie es gerochen haben muss. Wie der Atem der Studierenden dampfte im Winter, wie sie die Luft anhielten, wenn die erste Schnittbewegung getan war. Wie Wissen sich über Körper spannte, buchstäblich. Das Teatro Anatomico ist nicht nur ein anatomisches Theater, sondern eine Art stillgelegte Idee davon, wie man sich Welt einmal erschlossen hat: durch Öffnen. Durch das Zeigen dessen, was man sonst bedeckt hält.
Die Wände sind mit Holzvertäfelung verkleidet, hell und warm, fast freundlich. Engel mit gespannten Muskeln hängen über dem Lehrstuhl – die sogenannten „Spellati“, Häutete, dargestellt ohne Haut, dafür mit Adern, Sehnen, Muskeln. Sie wirken nicht grausam, sondern fast zart. Wie Menschen, bei denen man vergessen hat, sie fertig zu zeichnen.
Ich sitze eine Weile einfach nur da. Es ist kühl. Ein paar andere Besucher flüstern. Ich denke an meine eigene Haut. An alles, was man nicht sieht. Und an das absurde Vertrauen, das wir unserem Körper jeden Tag entgegenbringen. Dass er funktioniert. Dass das Herz schlägt. Dass das Gehirn weiter sendet. Und vielleicht ist genau das der Grund, warum mich dieser Ort so berührt: weil er die radikale Zerbrechlichkeit unseres Wissens zeigt. Und gleichzeitig die Schönheit darin, zu versuchen, etwas zu begreifen. Ganz wörtlich.
Zwei Museen meiner Wahl
Nationalgalerie Bologna | Die Pinacoteca Nazionale gilt als das bedeutendste Kunstmuseum Bolognas und zählt zu den wichtigsten Gemäldegalerien Italiens. Untergebracht im ehemaligen Jesuitenkolleg im Kloster Sant’Ignazio, nur wenige Schritte von der Universität entfernt, bietet die Galerie einen tiefen Einblick in die Entwicklung der Malerei in der Region Emilia-Romagna vom 13. bis zum 18. Jahrhundert. Besonders stark vertreten ist die sogenannte „Bologneser Schule“, eine Strömung, die insbesondere im Barock durch Künstler wie Guido Reni, Guercino oder die Brüder Carracci große Bedeutung erlangte. Die Pinacoteca zeigt aber auch Meisterwerke aus der Frührenaissance, darunter Werke von Giotto, Vitale da Bologna oder Raffael. Der Aufbau der Sammlung folgt weitgehend einer chronologischen Struktur und ist zugleich didaktisch klar gegliedert – ideal, um nicht nur die Stilentwicklung, sondern auch die gesellschaftlichen und religiösen Kontexte der Kunst zu verstehen. Die Räume sind ruhig, großzügig und atmosphärisch, was einen sehr konzentrierten, fast meditativen Besuch ermöglicht. Wer sich für italienische Malerei interessiert, wird in der Pinacoteca einen tiefen Zugang zu einem oft unterschätzten Kapitel der Kunstgeschichte finden.Museo
Das Archäologische Museum, das Museo Civico Archeologico, liegt zentral im Palazzo Galvani direkt an der Piazza Maggiore, nur einen Steinwurf von der imposanten Basilika San Petronio entfernt. Es beherbergt eine der bedeutendsten archäologischen Sammlungen Italiens – besonders reich an etruskischen und römischen Fundstücken aus Bologna und der Umgebung, die in der Antike als Felsina bekannt war. Die Ausstellung ist sorgfältig kuratiert und führt Besucher chronologisch durch die Geschichte der Region: von der Ur- und Frühgeschichte über die Blütezeit der Etrusker bis zur römischen Kolonie Bononia. Besonders beeindruckend ist der etruskische Abschnitt, der seltene Grabbeigaben, Alltagsgegenstände und kunstvolle Keramik zeigt – ein faszinierendes Fenster in eine Kultur, die oft im Schatten Roms steht. Darüber hinaus beherbergt das Museum eine außergewöhnliche Sammlung ägyptischer Antiquitäten mit Mumien, Särgen und kultischen Objekten, die den Horizont weit über Bologna hinaus öffnen. Das Museo Civico Archeologico ist damit nicht nur für Archäologiebegeisterte, sondern auch für alle, die Bolognas antike Wurzeln verstehen möchten, ein absolutes Muss – es verbindet wissenschaftliche Tiefe mit einer sinnlich erfahrbaren Ausstellungsgestaltung.
Die Geheimnisse der Stadt
Wenn in Bologna (oder allgemein in italienischen Städten) von „Geheimnissen“ die Rede ist, die man „besichtigen“ kann, meint man damit in der Regel kleine, unscheinbare Orte, Details oder architektonische Besonderheiten, die nicht auf den ersten Blick auffallen – aber eine Geschichte erzählen, überraschen oder berühren. Es sind oft keine „Geheimtipps“ im Sinne von unentdeckten Orten, sondern eher kulturelle, fast poetische Kuriositäten, die den Charakter der Stadt besonders spürbar machen.
Das „Flüstergewölbe“ – Voltone del Podestà: Unter dem Torre dell’Arengo am Piazza Maggiore liegt ein Kreuzgewölbe, das wie ein unspektakulärer Durchgang aussieht – bis man ein leises Spiel entdeckt: Wenn zwei Personen sich diagonal gegenüber in die Ecken stellen und einer ganz leise spricht, hört der andere jedes Wort, als stünde er direkt daneben. Akustik, die Magie wird. Früher flüsterten hier wohl auch Beichtende mit Geistlichen – heute sind es Liebeserklärungen, Kindergelächter oder neugierige Tourist*innen.
Das Fenster zum „Klein-Venedig“ – Finestrella di Via Piella: Bologna war früher von einem dichten Netz an Kanälen durchzogen – das man heute kaum noch sieht. Doch in der Via Piella verbirgt sich in einer Hauswand ein kleines Fenster. Wenn man es öffnet, blickt man unvermittelt auf ein romantisches Stück Wasserstraße, eingerahmt von Häusern – wie in Venedig. Man erwartet es nicht – und ist genau deshalb kurz sprachlos.
Die Lampe der Neugeborenen – La Lampada dei Neonati: Man läuft leicht daran vorbei – und merkt erst später, dass man etwas verpasst hat. An einer Hauswand der Via San Vitale, ganz in der Nähe des alten Ospedale di Santa Maria della Vita, brennt eine kleine Lampe. Meist still, manchmal kaum sichtbar, aber immer da. Sie trägt den Namen Lampada dei Neonati – Lampe der Neugeborenen. Früher war sie mit dem Krankenhaus verbunden, in dem Kinder zur Welt kamen. Immer wenn ein neues Leben geboren wurde, wurde diese kleine Lampe entzündet. Heute leuchtet sie dauerhaft. Nicht, weil ständig Kinder geboren werden – sondern als stilles Symbol: für das Wunder des Anfangs. Für das Lebenslicht. Für all die Namen, die noch nicht gesprochen werden können. Es ist ein Ort, der nichts „zeigt“, aber viel bedeutet. Wer kurz innehält, merkt, wie zart ein öffentlicher Raum plötzlich intim werden kann. Und dass Erinnerung und Hoffnung manchmal in einer einzigen kleinen Flamme wohnen.
Die drei Pfeile im Holzbalken – Corte Isolani: In einem der Bögen im Durchgang zur edlen Corte Isolani in der Strada Maggiore stecken – fast unsichtbar – drei echte Pfeile im Holzbalken der Decke. Der Legende nach wurden sie von Attentätern abgeschossen, die durch den plötzlichen Anblick einer nackten Frau abgelenkt wurden (eine Geschichte, die natürlich so absurd ist, dass man sie fast glauben möchte). Die Pfeile blieben stecken – und sind heute stumme Zeugen eines mythischen Moments.
Die unsichtbare Fassade – Basilica di San Petronio: Auch kein echtes Geheimnis mehr, aber ein schönes: Die riesige Hauptkirche am Piazza Maggiore hat bis heute keine vollendete Fassade. Der untere Teil ist mit weißem Marmor verkleidet, der obere jedoch nur roter Backstein. Der Grund: Geldnot, politische Konflikte – und vielleicht die Tatsache, dass Schönheit in Bologna nie gleich Perfektion war.
Ein paar Schritte weiter: das ehemalige jüdische Viertel. Die Straßen werden enger, leiser, aufmerksamer. Keine großen Denkmäler, keine touristischen Markierungen. Und doch: spürbar. Auf der Via de’ Giudei hängt eine kleine Erinnerungstafel, zurückhaltend, leicht übersehen. Ich bleibe stehen. Die Luft verändert sich. Es ist immer wieder dieser Moment, in dem man merkt, dass Geschichte nicht vergangen ist, sondern Raum einnimmt. Leise, durchlässig, aber da.
Ausflug nach San Luca,
oder doch nach Mailand, Venedig oder Rimini?
.png) |
| Ausblick von San Luca |









.png)













.png)
.png)


.png)
.png)
.png)
.png)
.png)

.png)
.png)
.png)
.png)
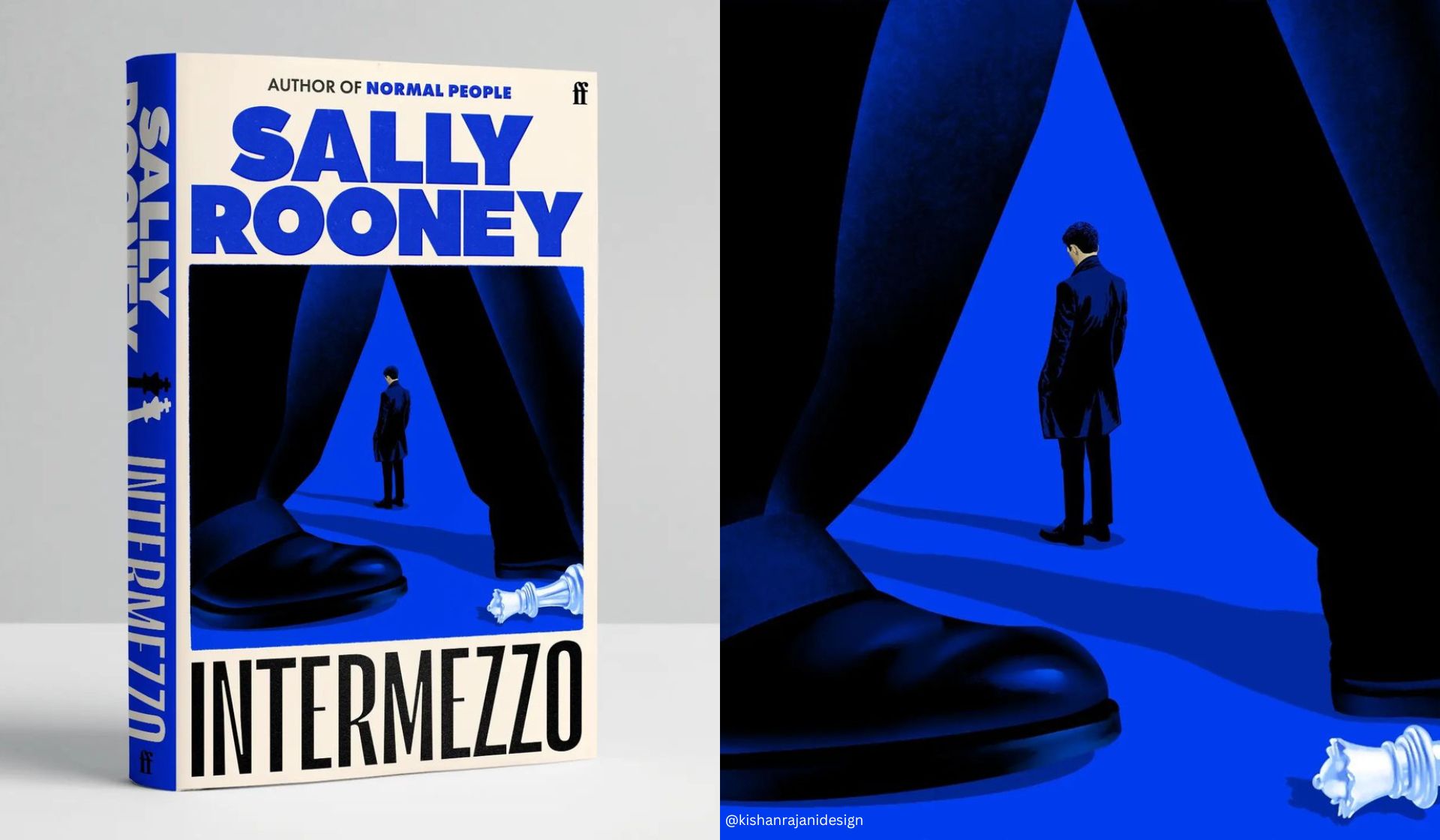


.png)
.png)
.png)
.png)
.png)





.png)

